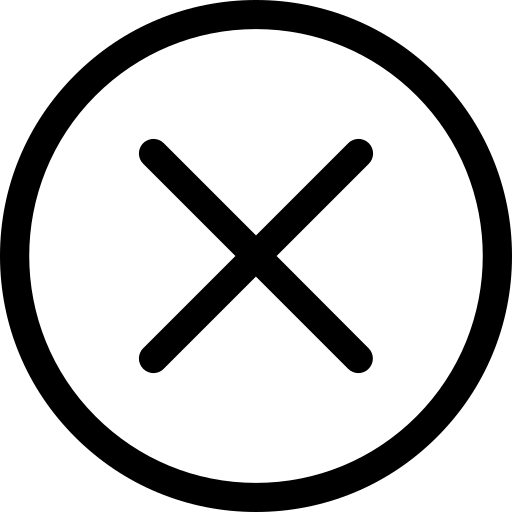Ein herzliches Willkommen den Kunden der Dr. Jung Treuhand GmbH auf der Homepage der VERBEG Immobilienverwaltung GmbH. Die Verschmelzung der beiden Firmen Dr. Jung Treuhand GmbH und VERBEG Immobilienverwaltung GmbH führt zur Vereinheitlichung der Arbeitsprozesse sowie zur besseren Erreichbarkeit und schnelleren Bearbeitung Ihrer Angelegenheiten.
Die Dr. Jung Treuhand GmbH wurde zum 01.09.2023 mit der VERBEG Immobilienverwaltung GmbH verschmolzen.
Die VERBEG Immobilienverwaltung GmbH ist Ihre neue Ansprechpartnerin. Die bisherigen Sachbearbeiter bleiben weiterhin für Sie zuständig.